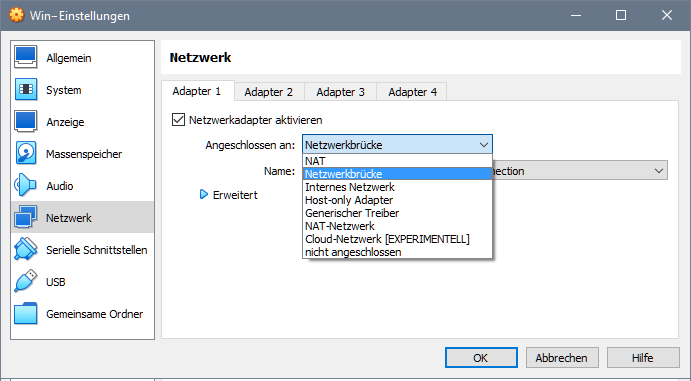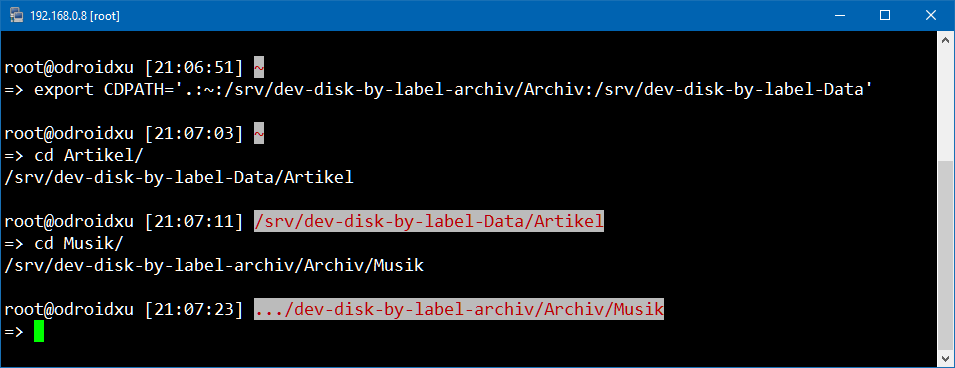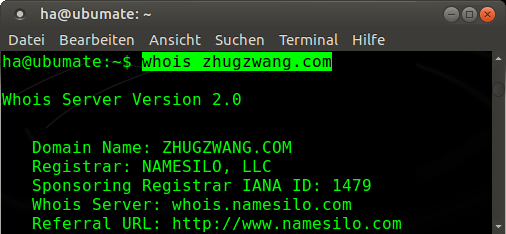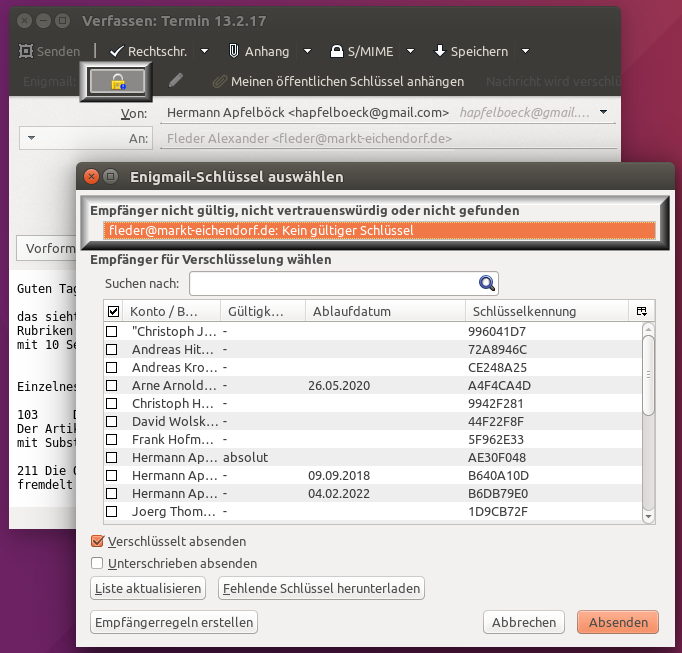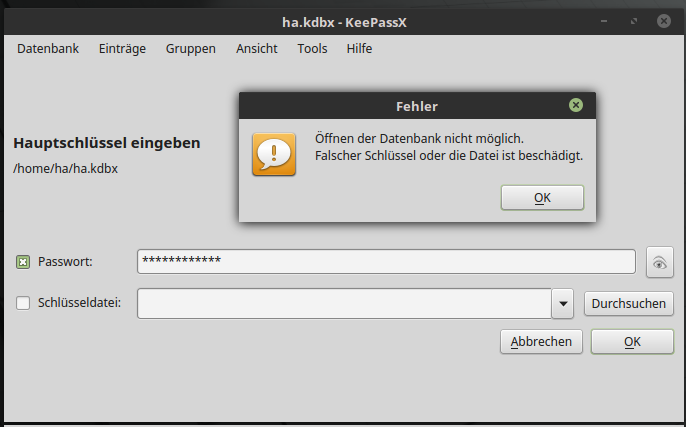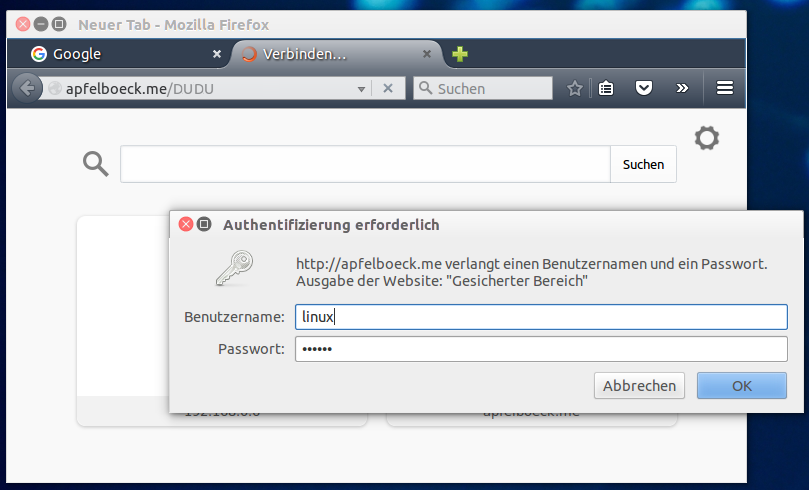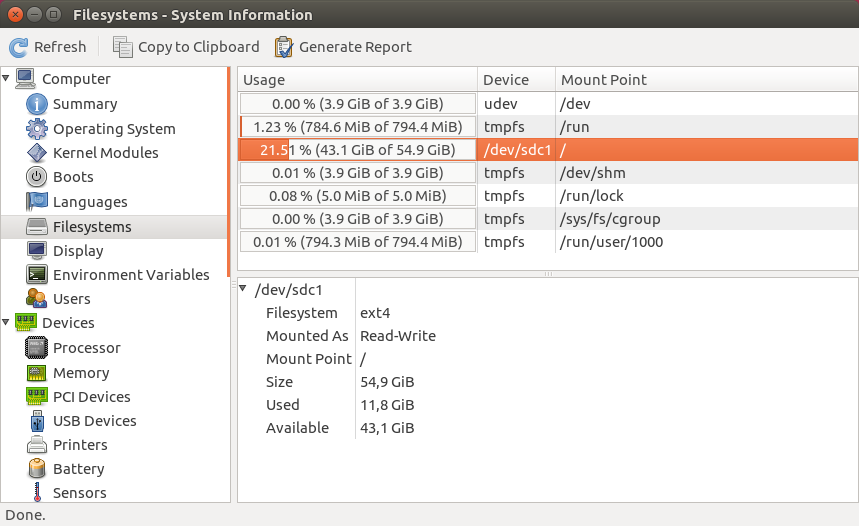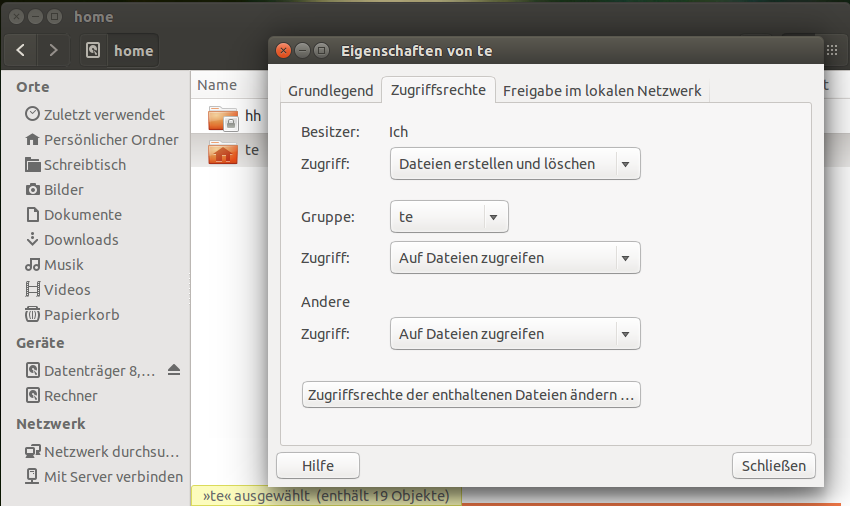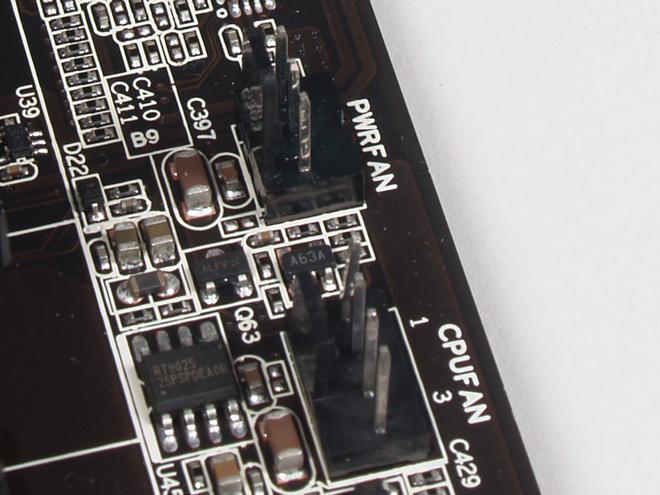Windows-Dienste (oder Services) sind größtenteils unentbehrliche Hintergrundprozesse, die Windows NT (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10) beim Systemstart automatisch lädt. Microsoft sorgt aber von jeher dafür, dass Windows für alle Situationen gerüstet ist. Daher lädt ein Standard-Windows auch diverse Dienste, die sich ungestraft beenden lassen.
Zu den nachfolgenden Windows-Diensten erhalten Sie eine knappe Erläuterung. Die Beschreibung soll vor allem Relevanz oder Irrelevanz des jeweiligen Dienstes verdeutlichen.
Die üblichen Werkzeuge zur Bearbeitung der Windows-Dienste sind
- die Dienste-Konsole Services.msc
- das Kommandozeilen-Programm SC.exe
- die Registry unter HKEY_Local_Machines\System\CurrentControlSet\Services
Die Windows-Dienste sind nach ihren internen Namen sortiert. Der „empfohlene“ Starttyp folgt meiner praktischen Erfahrung. Ohne Gewähr!
AeLookupSvc [Anwendungserfahrung]
Friendly Name: Anwendungserfahrung
Interner Name: AeLookupSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung: Der Dienst berücksichtigt auf Basis einer Datenbank bekannte Kompatibilitätsprobleme von Anwendungen und sorgt automatisch für die geeigneten Speichereinstellungen. Nach unserer Erfahrung ist dieser Service entbehrlich.
Abhängig von: Keinem anderen Dienst
Benötigt für: Keinen anderen Dienst…
ALG [Gatewaydienst auf Anwendungsebene]
Friendly Name: Gatewaydienst auf Anwendungsebene
Interner Name: ALG
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Hierbei handelt es sich um einen Dienst, der erforderlich ist, wenn per
Wählverbindung eine Internet Verbindung aufgebaut wird. Das ist nicht
nur bei Modem oder ISDN der Fall, sondern auch bei direkter DSL-Anwahl
per PPPoE. Wenn Sie allerdings über einen Router oder einen
Netzwerk-Server mit dem Internet verbunden sind, dann können Sie auf
diesen Dienst verzichten.
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: keinen anderen Dienst
Appinfo [Anwendungsinformationen]
Friendly Name: Anwendungsinformationen
Interner Name: Appinfo
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Unentbehrlicher Bestandteil des Sicherheitskonzeptes von Vista: Der
Dienst ändert entweder auf explizite Anforderung oder selbständig (bei
Software-Installationen) die Benutzerrechte. Auch wenn ein Benutzer mit
Administratoren-Rechten angemeldet ist, wird nicht jedes Programm
blindlings mit diesen Rechten gestartet. Sobald ein Programm versucht,
administrative Aktionen auszuführen, erscheint ein Dialog, in dem der
Anwender seine Zustimmung geben muss. Wenn Sie diesen Dienst
deaktivieren, können Benutzer keine Anwendungen mit zusätzlichen
Administratorprivilegien ausführen. So scheitert etwa der Start des
Registry-Editor (Regedit) oder der Dienste-Konsole (Services.msc).
Sollten Sie den Dienst bereits deaktiviert haben und möchten ihn wieder
aktivieren, dann starten Sie den PC im abgesicherten Modus und rufen von
dort aus den Dienste-Manager auf.
Abhängig von: Benutzerprofildienst, RPC-Locator, DCOM-Server-Prozesstart
Benötigt für: Keinen anderen Dienst
AppMgmt [Anwendungsverwaltung]
Friendly Name: Anwendungsverwaltung
Interner Name: AppMgmt
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert auf Home-PC
Beschreibung: Der Dienst ist nur in Firmennetzen mit Gruppenrichtlinien und Active Directory-Servern erforderlich. Er verarbeitet Installations- und Deinstallationsanforderungen für Software, die über Gruppenrichtlinien bereitgestellt wird. Den Home-Versionen von Vista fehlt dieser Service, unter Vista-Ultimate auf einem Home-PC kann er getrost deaktiviert werden.
Abhängig von: Keinem anderen Dienst
Benötigt für: Keinen anderen Dienst
Audiosrv [Windows-Audio]
Friendly Name: Windows-Audio
Interner Name: Audiosrv
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst vermittelt die angeschlossenen Audiogeräte an alle
Windows-basierten Anwendungen. Wenn Sie diesen Dienst deaktivieren,
bleibt die Soundkarte definitv stumm.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Multimediaklassenplaner, Plug & Play,
Remoteprozeduraufruf (RPC), Windows-Audio-Endpunkterstellung
Benötigt für:
keinen anderen DienstBfe [Basisfiltermodul]
Friendly Name: Basisfiltermodul
Interner Name: BFE
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der Dienst sorgt für die grundlegenden Filterregeln der Windows-Firewall
oder einer alternativen Firewall. Das Deaktivieren des
Basisfiltermoduls würde die Sicherheit des Rechners verringern.
Abhängig von:
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Gemeinsame Nutzung der Internet-Verbindung, Windows-Firewall, Routing und RAS
BITS [Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst]
Friendly Name: Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst
Interner Name: BITS
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Im Wesentlichen handelt es sich bei diesem Dienst um einen
Downloadmanager. Er gewährleistet z.B. bei automatischen Windows Updates
und anderen im Hintergrund ablaufenden Downloads, dass ungenutzte
Bandbreite optimal ausgenutzt wird. Wird ein im Hintergrund ablaufender
Download unterbrochen, so sorgt der Intelligente
Hintergrundübertragungsdienst dafür, dass dieser zu einem späteren
Zeitpunkt automatisch wieder aufgenommen wird.
Achtung: Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, funktionieren automatische Windows Updates nicht mehr.
Abhängig von: COM+-Ereignissystem, DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
Browser [Computerbrowser]
Friendly Name: Computerbrowser
Interner Name: Browser
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst führt eine aktuelle Liste aller Computer und Geräte
(Router, NAS) im Windows-Netzwerk und gibt sie an als Browser
fungierende Computer weiter. Die Liste wird nicht aktualisiert oder
gewartet, falls Sie den Dienst beenden. Das heisst: Netzwerkgeräte
werden unter Umständen nicht mehr angezeigt.
Der Dienst ist in jedem LAN-Netzwerk sinnvoll (ein PC mit DSL-Router ist
bereits ein LAN!), lässt sich aber in größeren Netzen auf normalen
Arbeitsrechnern deaktivieren, solange ein Server im Netz diesen Dienst
anbietet. Wir empfehlen den Starttyp „automatisch“, für absolute
Minimalkonfigurationen ist der Dienst theoretisch entbehrlich.
Um den Dienst „Server“ (für Netzwerkfreigaben) abzuschalten, müssen Sie auch diesen Dienst deaktivieren.
Abhängig von: Arbeitsstationsdienst, DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Server, Sicherheitskonto-Manager, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst
Benötigt für: keinen anderen Dienst
CertPropSvc [Zertifikatverteilung]
Friendly Name: Zertifikatverteilung
Interner Name: CertPropSvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dient dem Management von Smartcard-Zertifikaten. Microsoft hat seit
Vista zahlreiche Smartcard Dienste umgesetzt, aber der Standardanwender
dürfte diese wohl in den seltensten Fällen nutzen. Smartcards werden von
manchen Firmen statt eines Passworts für die Benutzeranmeldung
verwendet. Wenn Sie keine Smartcard-Lesegeräte einsetzen, benötigen Sie
diesen definitiv Dienst nicht.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
clr_optimization_v2.0.50727_32 [Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86]
Friendly Name: Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
Interner Name: clr_optimization_v2.0.50727_32
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst (Ngen.exe) erstellt Dateien, die Prozessor-spezifischen
Maschinen-Code enthalten und legt diese im “Native Image Cache“ des
betreffenden Computers ab. Zum Tragen kommt dies typischerweise nach
System-Updates, wenn die “Runtime Engine“ auf diese Images zurückgreift.
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: keinen anderen Dienst
ComSysApp [COM+ Systemanwendung]
Friendly Name: COM+ Systemanwendung
Interner Name: COMSysApp
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst COM+ Systemanwendung verwaltet laut Microsoft die
Konfiguration und Überwachung von COM+-basierten Komponenten. Entgegen
Microsoft’s Aussagen funktionieren aber die meisten COM+-basierten
Komponenten auch ohne diesen Dienst ordnungsgemäß. Wir empfehlen den
Starttyp „manuell“, konnten aber auch mit „deaktiviert“ keine
nachteiligen Nebenwirkungen feststellen. Daher lässt sich der Dienst für
absolut „minimale“ Konfigurationen durchaus deaktivieren.
Abhängig von: Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse, Remoteprozeduraufruf (RPC), COM+Ereignissystem
Benötigt für: keinen anderen Dienst
CryptSvc [Kryptographiedienste]
Friendly Name: Kryptographiedienste
Interner Name: CryptSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Unentbehrlich, nicht zuletzt für das Windows-Update: Die
Kryptografiedienste stellen die Schlüsselverwaltung für den Computer
bereit und bestehen aus verschiedenen Komponenten:
Der Katalogdatenbankdienst ist für das Hinzufügen, Entfernen und
Durchsuchen von Katalogdateien verantwortlich. Katalogdateien werden
verwendet, um alle Dateien im Betriebssystem zu signieren. Der
Windows-Dateischutz (WFP), die Treibersignatur und das Setup verwenden
diesen Dienst.
Der Dienst für geschützten Stammspeicher ist für das Hinzufügen und
Entfernen von Zertifikaten vertrauenswürdiger
Stammzertifizierungsstellen verantwortlich.
Der Schlüsseldienst ermöglicht es Administratoren, Zertifikate im
Auftrag des lokalen Computerkontos zu registrieren. Da der wichtige
Dienst nicht permanent erforderlich ist, empfehlen wir den Starttyp
„manuell“.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für: keinen anderen Dienst
CscService [Offlinedateien]
Friendly Name: Offlinedateien
Interner Name: CscService
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst hält den Offline-Dateicache auf dem aktuellen Stand. Er
reagiert auf die An- und Abmeldung von Benutzern. Wenn Sie nicht planen,
Daten von angeschlossenen Netzwerkrechnern auf Ihrem PC
zwischenzuspeichern (und damit auch verfügbar zu halten, wenn die
Netzwerkressourcen offline sind), dann benötigen Sie diesen Dienst
nicht.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
DcomLaunch [DCOM-Server-Prozessstart]
Friendly Name: DCOM-Server-Prozessstart
Interner Name: DcomLaunch
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Absolut unentbehrlicher Dienst und daher in der Dienste-Konsole
(Services.msc) nicht deaktivierbar! Wenn der Dienst gewaltsam via
Registry deaktiviert wird, läuft der abhängige Schlüsseldienst RPC nicht
mehr und damit rund fünfzig weitere Dienste. Finger weg!
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: Basisfiltermodul, Remoteprozeduraufruf (RPC) und viele weitere Dienste
DFSR [DFS-Replikation]
Friendly Name: DFS-Replikation
Interner Name: DFSR
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst dient dazu, Dateien auf mehrere Netzwerk-Server zu
verteilen und in einem virtuellen Ordner zusammenzufassen
(DFS=Distributed File System). Die allermeisten Anwender werden diese
besonders effektive Datenverteilung niemals verwenden. Dennoch wird der
Dienst bei einigen Windows-Versionen automatisch gestartet.
Wir empfehlen, den Dienst zu deaktivieren, sofern sich der PC nicht
ausdrücklich in einer DFS-fähigen LAN-Umgebung (in der Regel innerhalb
einer Windows-Domäne) befindet.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), COM+-Ereignissystem
Benötigt für: keinen anderen Dienst
Dhcp [DHCP-Client]
Friendly Name: DHCP-Client
Interner Name: Dhcp
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst ist für diverse Netzwerk Funktionen zuständig. Er
registriert unter anderem IP-Adressen und DNS-Namen und hält diese auf
dem neusten Stand. Notwendig ist dieser Dienst aber nur, wenn Sie einen
DHCP-Server in Ihrem Netzwerk einsetzen (Standard in größeren
LAN-Umgebungen, aber auch bei DSL-Routern).
Ohne DHCP-Server müssen Sie die TCP/IP Einstellungen für die
Netzwerkkarten fest einstellen, und in diesem Fall können Sie diesen
Dienst ohne Nachteile abschalten,
Abhängig von: Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst
Benötigt für: WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst
Dnscache [DNS-Client]
Friendly Name: DNS-Client
Interner Name: Dnscache
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der DNS-Client speichert Anfragen an einen DNS-Server zwischen, so dass
die IP-Adresse bei späteren Anfragen schneller gefunden wird. In
schnellen Netzwerken oder bei DSL-Verbindungen ist das nicht unbedingt
erforderlich, mitunter sogar nachteilig: Da nicht einstellbar ist, wie
lange ein Domain-Name im Cache verbleibt, gibt der DNS-Client eventuell
auf eine falsche IP-Adresse zurück, wenn ein Server plötzlich eine
andere Adresse hat. Für langsame Internet-Anbindungen, wie etwa per
Modem, kann dieser Dienst sich jedoch als hilfreich erweisen.
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: keinen anderen Dienst
Dot3svc [Automatische Konfiguration (verkabelt)]
Friendly Name: Automatische Konfiguration (verkabelt)
Interner Name: dot3svc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst unterstützt die automatische Konfiguration verkabelter
Netzwerke und ist unentbehrlich in allen LAN-Umgebungen. Die
Voreinstellung „manuell“ genügt allerdings.
Abhängig von: EapHost, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
DPS [Diagnoserichtliniendienst]
Friendly Name: Diagnoserichtliniendienst
Interner Name: DPS
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst spürt Speicher-, Festplatten- und Netzwerkprobleme auf und
meldet sie dem Anwender. In besonderen Fällen kann er zudem direkt ein
Troubleshooter-Programm auslösen. So ist etwa auch die Option „Diagnose
und Reparatur“ im „Netzwerk- und Freigabecenter“ auf diesen Dienst
angewiesen.
Auf störungsfrei laufenden Vista-PCs sehen wir dennoch keinen Grund,
diesen Dienst permanent laufen zu lassen und empfehlen als Starttyp
„deaktiviert“. Bei undurchsichtigen Problemfällen können Sie den Dienst
gegebenenfalls jederzeit wieder starten.
Zum Vista-Diagnose-System gehört neben dem „Diagnoserichtliniendienst“ auch der Diagnosesystemhost.
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: keinen anderen Dienst
EapHost [Extensible Authentication-Protkoll]
Friendly Name: Erkennung interaktiver Dienste
Interner Name: EapHost
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst stellt eine austauschbare Infrastruktur für verschiedene
Authentifizierungsmethoden bereit. Betroffen sind dabei VPN und
Dial-Up-Verbindungen. Auch wenn Sie sich bei Wireless Access Points
anmelden möchten, sollten Sie davon absehen, diesen Dienst ganz zu
deaktivieren.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, CNG-Schlüsselisolation, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: Automatische Konfiguration (verkabelt), Automatische WLAN-Konfiguration
ehRcvr [Windows Media Center-Empfängerdienst]
Friendly Name: Windows Media Center-Empfängerdienst
Interner Name: ehRcvr
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Diesen Dienst benötigt das Windows Media Center für den Empfang von
Fernseh- und Radioübertragungen. Wenn Sie das Windows Media Center nicht
oder jedenfalls nicht zu diesem Zweck nutzen, können Sie den Dienst
deaktivieren.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
ehSched [Windows Media Center-Planerdienst]
Friendly Name: Windows Media Center-Planerdienst
Interner Name: ehSched
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Mit Hilfe dieses Dienstes steuert das Windows Media Center den Aufnahmestart und Aufnahmestopp von TV-Sendungen. Wenn Sie das Windows Media Center nicht oder jedenfalls nicht zu diesem Zweck nutzen, können Sie den Dienst deaktivieren.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
ehstart [Startprogramm für Windows Media Center]
Friendly Name: Windows Media Center-Planerdienst
Interner Name: ehSched
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Mit Hilfe dieses Dienstes steuert das Windows Media Center den
Aufnahmestart und Aufnahmestopp von TV-Sendungen. Wenn Sie das Windows
Media Center nicht oder jedenfalls nicht zu diesem Zweck nutzen, können
Sie den Dienst deaktivieren.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
EMDMgmt [ReadyBoost]
Friendly Name: ReadyBoost
Interner Name: EMDMgmt
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ist Basis der neuen Vista-Funktion, USB-Flash-Laufwerke und
USB-Sticks als zusätzlichen Festplatten-Cache nutzen zu können. Aktuell
sind aber noch viele Flash Laufwerke zu langsam für diese Aufgabe. Sie
ist ferner entbehrlich, wenn der PC ausreichend Speicher besitzt (1 GB
aufwärts) oder kein passender Flash-Speicher vorliegt. Im übrigen ist
auch bei tauglichen USB-Sticks nach meiner Erfahrung kein spürbarer
„Boost“ zu erwarten. Daher lautet meine Empfehlung „deaktiviert“.
Abhängig von: DCOM-Server-Prozessstart, Softwarelizenzierung, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
EndpointBuilder [Windows-Audio-Endpunkterstellung]
Friendly Name: Windows-Audio-Endpunkterstellung
Interner Name: EndpointBuilder
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der Dienst verwaltet Audiogeräte wie Lautsprecher oder Mikrophone und
unterstützt dabei den “Windows Audio” Dienst. Vermutlich wurde er auf
Grund umfassenderer “Digitaler Rechteverwaltung“ aus dem
“Windows-Audio“-Dienst seit Windows Vista ausgekoppelt. Da “Windows
Audio“ ohne die Endpunkterstellung nicht gestartet werden kann, sollten
Sie den Dienst nicht deaktivieren, wenn die Soundkarte arbeiten soll.
Abhängig von: Plug & Play,
Benötigt für: Windows-Audio
Eventlog [Windows-Ereignisprotokoll]
Friendly Name: Windows-Ereignisprotokoll
Interner Name: Eventlog
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der Dienst protokolliert zahlreiche vordefinierte System-, Hardware- und
Anwendungsereignisse. Letztere können unter „verwaltung,
ereignisanzeige“ im “XML“ oder “Plain Text“ Format ausgegeben werden.
Das Beenden dieses Dienstes kann zu Systeminstabilität führen, zumal die
Aufgabenplanung von diesem Dienst abhängt.
Abhängig von: keinem anderen Dienst
Benötigt für: Aufgabenplanung
EventSystem [COM+ Ereignissystem]
Friendly Name: COM+ Ereignissystem
Interner Name: EventSystem
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Wichtig, aber nicht überall zwingend erforderlich: Der Dienst
unterstützt den Systemereignis-Benachrichtigungsdienst (SENS), der die
automatische Verteilung von Ereignissen an COM-Komponenten zur Verfügung
stellt. Wenn der Dienst beendet ist, wird SENS beendet und ist nicht in
der Lage,
Anmelde- und Abmeldebenachrichtigungen zur Verfügung zu stellen.
Dies kann die Zusammenarbeit von Software- und System-Komponenten beeinträchtigen.
Abhängig von:
Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse, COM+-Systemanwendung, DFS-Replikation, Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst
Fax [Fax]
Friendly Name: Fax
Interner Name: Fax
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell oder deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht das Senden und Empfangen von Telefax. Wenn Sie
diese Funktion auf Ihrem PC nicht nutzen, können Sie den Dienst
deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Telefonie, Plug & Play, Remoteprozeduraufruf (RPC), Druckerwarteschlange
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
fdPHost [Funktionssuchanbieter-Host]
Friendly Name: Funktionssuchanbieter-Host
Interner Name: fdPHost
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst wird vom Windows Media Center genutzt. Verschiedene mit
einem Computernetzwerk verbundene Geräte können erkannt werden. Neben
manchen Kameras und Druckern ist Microsofts “Media Center Extender“ eine
der nennenswerteren Geräte. Wenn Sie das Media Center nicht nutzen oder
das Setup für angeschlossene Geräte manuell vornehmen, können Sie den
Dienst ungestraft deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
PnP-X-IP-Busauflistung, Windows Media Center Extender-Dienst
fhsvc [File History Service]
Friendly Name: File History Service
Interner Name: fhsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ist notwendig, wenn Sie die Sicherungskomponente „File
History“ von Windows 8 verwenden wollen. Der Dienst ersetzt die ältere
„Windows-Sicherung“ (SDRSVC) von Windows 7 und Vista.
Abhängig von:
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
FDResPub [Funktionssuche-Resourcenveröffentlichung]
Friendly Name: Funktionssuche-Resourcenveröffentlichung
Interner Name: FDResPub
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst liefert anderen Computern im Netzwerk Informationen über den
PC, auf dem dieser Dienst läuft. Insbesondere geht es um daran
angeschlossene Geräte wie etwa Laufwerke oder Drucker. Wenn Sie diesen
Dienst deaktivieren, werden die Ressourcen des betreffenden Computers
von anderen Netzwerkteilnehmern nicht mehr erkannt.
Auf Home-PCs können Sie diesen Dienst in der Regel deaktivieren.
Netzwerkfreigaben sind übrigens davon nicht betroffen – dafür ist der Dienst „Server“ zuständig.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
FontCache3.0.0.0 [Windows Presentation Foundation-Schriftartcache 3.0.0.0]
Friendly Name: Windows Presentation Foundation-Schriftartcache 3.0.0.0
Interner Name: FontCache3.0.0.0
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst optimiert die Performance von “Windows Presentation
Foundation”-Anwendungen (WPF oder „Avalon“), indem gemeinsam genutzte
Schriftarten in einem gemeinsamen Cache hinterlegt werden. WPF auf der
Basis von .NET Framework 3.0 und höher soll zügig die bisherige
Win32-API ersetzen. Wenn Sie diesen Dienst aktivieren, wird sich dies
negativ auf den Ablauf von WPF-Anwendungen auswirken.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
gpsvc [Gruppenrichtlinienclient]
Friendly Name: Gruppenrichtlinienclient
Interner Name: gpsvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht es LAN-Administratoren einer Windows-Domäne,
auf der jeweiligen Workstation Einstellungen und Restriktionen für das
System und Anwendungen gemäß vordefinierter Gruppenrichtlinien
festzulegen.
Wenn Ihr Computer nicht Bestandteil eines Netzwerkes ist, sondern
lediglich dem Heimgebrauch dient, dann können Sie auf diesen Dienst
verzichten. Gleiches gilt, wenn Sie sich in einem LAN ohne Domäne
anmelden. Eine Domänenanmeldung ohne diesen Windows-Dienst scheitert.
Der Gruppenrichtlinienclient kann allerdings weder über Services.msc,
noch via Registry
(Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\gpsvc,
DWord-Eintrag „Start=4“) noch über das Kommandozeilen-Tool SC.EXE („sc
stop gpsvc…“) deaktiviert werden. Es sind erst Rechteänderungen
notwendig, um diesen Dienst abzuschalten.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
hidserv [Zugriff auf Eingabegeräte]
Friendly Name: Zugriff auf Eingabegeräte
Interner Name: hidserv
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der englische Name ist mit „Human Interface Device Access“ etwas
aussagekräftiger. Der Dienst ermöglicht die Nutzung der Hot-Buttons von
Spezialtastaturen, Fernbedienungen, Scanner- und Fax-Geräten sowie von
Multimedia-Peripherie. Wenn Sie ihn deaktivieren, können Sie solche
Spezialtasten und Fernbedienungen in der Regel nicht mehr verwenden.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
hkmsvc [Integritätsschlüssel- und Zertifikatverwaltung]
Friendly Name: Integritätsschlüssel- und Zertifikatverwaltung
Interner Name: hkmsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell oder deaktiviert
Beschreibung:
Die Integritätsschlüssel- und Zertifikatverwaltung wird für die
Handhabung von X.509 Zertifikaten benötigt – aktuell der wichtigste
Standard für digitale Zertifikate. Diese Art der Zertifizierung kann für
sichere Protokolle wie etwa SSL/TLS, IPsec, S/MIME, Smartcard, SSH,
HTTPS, LDAPv3 und EAP notwendig sein.
Zwar finden diese Protokolle überwiegend bei Firmeneinstellungen
Verwendung, doch sie sind mitunter auch auf Heim-PCs notwendig, so etwa,
wenn die Windows-eigene EFS-Verschlüsselung genutzt wird und das
gespeicherte Zertifikat neu importiert werden muss.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
idsvc [Windows CardSpace]
Friendly Name: Windows CardSpace
Interner Name: idsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht Erstellung, Verwaltung und Zugriffsschutz
digitaler Identitäten. CardSpace kann insbesondere zur Authentifizierung
bei Web-Seiten und Web-Diensten verwendet werden. In der Praxis hat
sich diese Microsoft-eigene Authentifizierungsmethode aber kaum
etabliert.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
IKEEXT [IKE- und AuthIP Ipsec-Schlüsselerstellungsmodule]
Friendly Name: IKE- und AuthIP IPsec-Schlüsselerstellungsmodule
Interner Name: IKEEXT
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Diese Schlüsselerstellungsmodule werden zur Authentifizierung und zum
Schlüsselaustausch in IPSec (Internet Protocol Security) verwendet, also
dann benötigt, wenn Sie auch auf IPsec zurückgreifen. Auch manche
VPN-Clients (für den Home-Zugriff auf den Firmen-Server) sind auf den
Dienst angewiesen.
Eigentlich eher für Firmennetzwerke von Interesse, empfiehlt Microsoft
dennoch ausdrücklich, diesen Dienst in jedem Fall aktiviert zu lassen.
Abhängig von:
Basisfiltermodul, DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Imhosts [TCP-IP-NetBIOS-Hilfsdienst]
Friendly Name: TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst
Interner Name: Imhosts
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst unterstützt “NetBIOS over TCP/IP“. Dabei handelt es sich um
ein Netzwerkhilfsprotokoll (NBT), das es ermöglicht, Netbios-basierte
Programme und Computer in einem TCP/IP Netzwerk (also im Internet) zu
verwenden. Falls in einem Netzwerk keine Alt-Rechner (Windows 95) mit
uralten Netbios oder WINS (Windows Internet Naming Service) beteiligt
sind, ist dieser Dienst mehr als überflüssig.
Abhängig von:
Keinem andern Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
IPBusEnum [PnP-X-IP-Busauflistung]
Friendly Name: PnP-X-IP-Busauflistung
Interner Name: IPBusEnum
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Die Plug & Play Extensions (PnP-X) erweitern das physikalische Plup
& Play um Netzwerkfunktionalität. PnP-X erkennt Geräte im Netzwerk
und unterstützt die automatische Installation derselben. Die
„PnP-X-IP-Busauflistung“ verwaltet den “Virtual Network Bus” und ist der
Basisdienst, der die erkannten Geräte an den Plug & Play-Dienst
meldet. Dieser Dienst ist nur in Ausnahmefällen, am Home-PC nur für das
Windows Media Center von Belang.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Funktionssuchanbieter-Host, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Windows Media Center Extender-Dienst
iphlpsvc [IP-Hilfsdienst]
Friendly Name: IP-Hilfsdienst
Interner Name: iphlpsvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht IPv6 Verbindungen über ein IPv4 Netzwerk. Da es
sich beim Internet noch größtenteils um ein IPv4 Netzwerk handelt, sind
Sie auf diesen Dienst angewiesen, sobald Sie auf eine IPv6-Site
zugreifen möchten.
Aktuell spielt IPv6 praktisch noch keine Rolle, so dass Sie diesen Dienst aktuell deaktivieren können.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst,
Remoteprozeduraufruf (RPC), Windows-Verwaltungsinstrumentation
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
keylso [CNG-Schlüsselisolation]
Friendly Name: CNG-Schlüsselisolation
Interner Name: keylso
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst speichert private Schlüssel zur Dechiffrierung von Daten
und hält diese für zukünftig aufgerufene Anwendungen bereit. Er
untersteht dem zentralen Prozess LSASS.EXE (Local Security Authority
Subsystem). Da der Dienst „keylso“ wichtig ist, aber nur bei Bedarf
ausgeführt wird, können Sie die Starteinstellung „manuell“ belassen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
Automatische Konfiguration (Verkabelt), Automatische WLAN-Konfiguration,
Extensible Authentication-Protokoll
KtmRm [KtmRm für Distributed Transaction Coordinator]
Friendly Name: KtmRm für Distributed Transaction Coordinator
Interner Name: KtmRm
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Zusätzliches Sicherheitsfunktion für die verteilten Netzwerkressourcen
des Distributed Transaction Coordinator: Der Dienst soll gewährleisten,
dass der Client-Computer auch nach einem Systemcrash Zugriff auf die
Netzressourcen erhält. Dieser Dienst ist nur sinnvoll, wenn der Rechner
auf verteilte Datenbanken im Netzwerk zugreift.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Sicherheitskonto-Manager
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
LanmanServer [Server]
Friendly Name: Server
Interner Name: LanmanServer
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch oder deaktiviert
Beschreibung:
Der Server-Dienst ist für Datei- und Druckerfreigaben zuständig. Auch
wenn Sie auf Ihrem Rechner keine Freigaben eingerichtet haben, startet
Windows standardmäßig diesen Dienst. Um ihn abschalten zu können, müssen
Sie zudem den Dienst „Computerbrowser“ beenden und deaktivieren.
Auf Home-PCs ohne weitere Netzrechner kann der Dienst deaktiviert
werden, desgleichen auf Firmenrechnern, die keine Daten freigeben.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Sicherheitskonto-Manager
Benötigt für:
Computerbrowser
LanmanWorkstation [Arbeitsstationsdienst]
Friendly Name: Arbeitsstationsdienst
Interner Name: LanmanWorkstation
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Unentbehrlich in Netzwerkumgebungen: Der Dienst erstellt und wartet
Client-Verbindungen mit Remoteservern unter Verwendung des
SMB-Protkolls. Ohne Arbeitsstationsdienst können keine Verbindungen zu
Rechnern, Freigaben oder Druckern aufgebaut werden. Lediglich der
Zugriff auf das Internet ist auch ohne den „Arbeitsstationsdienst“
möglich.
Abhängig von:
Browser
Benötigt für:
Computerbrowser, Netlogon, Terminaldienstekonfiguration
lltdsvc [Verbindungsschicht-Topologieerkennungs-Zuordnungsprogramm]
Friendly Name: Verbindungsschicht-Topologieerkennungs-Zuordnungsprogramm
Interner Name: lltdsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser entbehrliche Dienst scannt nach Ressourcen für die
Netzwerkübersicht im „Netzwerk- und Freigabecenter“ von Windows. Dabei
wird neben einigen anderen Informationen über angeschlossene Geräte auch
deren Verbindungsstatus dargestellt. Wenn Sie diesen Dienst
deaktivieren, schränken Sie die Funktion dieser Netzwerkübersicht nicht
grundsätzlich ein, sie wird nur eventuell langsamer oder unvollständig.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für: keinen anderen Dienst
Mcx2Svc [Windows Media Center Extender-Dienst]
Friendly Name: Windows Media Center Extender-Dienst
Interner Name: Mcx2Svc
Starttyp: deaktiviert
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst erstellt Verbindungen zu Erweiterungsgeräten für das Windows
Media Center. So kann dann etwa Microsofts XBox 360 verwendet werden, um
auf digitale Unterhaltungsmedien zuzugreifen, die auf einem Media
Center-PC gespeichert sind. Wenn Sie das Windows Media Center oder
dessen Extender-Funktionen nicht nutzen, sollten Sie diesen Dienst
deaktiviert lassen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Funktionssuchanbieter-Host, PnP-X-IP-Busauflistung,
Remoteprozeduraufruf (RPC), SSDP-Suche, Terminaldienste
Benötigt für: keinen anderen Dienst
MMCSS [Multimediaklassenplaner]
Friendly Name: Multimediaklassenplaner
Interner Name: MMCSS
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der Dienst weist den auf einem PC ablaufenden Tasks verschiedene
Prioritäts-Stufen zu, um die Gesamtleistung zu optimieren. Dabei werden
Multimedia-Anwendungen relativ weit oben angesiedelt. Dieser Dienst wird
von “Windows Audio“ benötigt und kann daher nur deaktiviert werden,
wenn der PC keinerlei Audio-Funktionen anbieten muss.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
Windows-Audio
MpsSvc [Windows-Firewall]
Friendly Name: Windows-Firewall
Interner Name: MpsSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Die Firewall schützt den Computer vor unberechtigten Zugriffen. Die
Windows-eigene Firewall mag zwar nicht die allerbeste auf dem Markt
sein, aber sie ist spätestens seit Windows Vista völlig ausreichend. Sie
sollten die Firewall daher nur deaktivieren, wenn Sie stattdessen die
Firewall eines anderen Anbieters installieren.
Abhängig von:
Basisfiltermodul, DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
MSDTC [Distributed Transaction Coordinator]
Friendly Name: Distributed Transaction Coordinator
Interner Name: MSDTC
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell oder deaktiviert
Beschreibung:
Der Transaktionsmanager-Dienst kommt bei SQL- und Personal Web-Servern
zum Einsatz, um Transaktionen zwischen den verschiedenen Computern des
Netzwerks zu koordinieren. Dabei wird die Kommunikation in einem
Server-Verbund optimiert, um schnellen Zugriff etwa auf verteilte
Datenbanken zu erzielen.
Im Prinzip können Sie die Starteinstellung “manuell“ beibehalten, weil
der Dienst, insofern er nicht durch ein anderes Programm gestartet
wurde, keine Systemleistung in Anspruch nimmt. Wenn Sie wissen, dass Ihr
PC auf keine verteilten Datenbanken im LAN zugreift, können Sie den
MSDTC aber jederzeit auch deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Sicherheitskonto-Manager
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
MSiSCSI [Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst]
Friendly Name: Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst
Interner Name: MSiSCSI
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst erlaubt Windows, über das Netzwerk via TCP/IP-Protokoll
eine Verbindung zu SCSI-Geräten (Small Computer System Interface)
aufzubauen. Bei iSCSI handelt es sich um ein relativ junges und nicht
besonders weit verbreitetes Datenübertragungsprotokoll. Daher ist am
Firmen-Rechner relativ unwahrscheinlich, am Home-PC nahezu
ausgeschlossen, dass Sie diesen Dienst benötigen.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Msiserver [Windows Installer]
Friendly Name: Windows Installer
Interner Name: msiserver
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Windows Installer installiert, repariert, und deinstalliert Software
gemäß der in den “Windows Installer“-Dateien (*.msi) enthaltenen
Anweisungen. Da die “Windows Installer“ Technik inzwischen von der
Mehrzahl der Software genutzt wird, sollten Sie diesen Dienst
keinesfalls deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Napagent [NAP-Agent (Network Access Protection)]
Friendly Name: NAP-Agent (Network Access Protection)
Interner Name: napagent
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert oder manuell (für Windows-Domäne)
Beschreibung:
Dieser Dienst erlaubt es Administratoren von Windows-Domänen,
Sicherheitsrichtlinien für Computer zu definieren, die auf sich mit dem
Netzwerk verbinden möchten. Der Dienst ist daher nur für Workstations in
einer LAN-Umgebung notwendig, die sich auf einer Windows-Domäne
anmelden müssen. Das gilt längst nicht für alle Firmen-PCs, ganz sicher
nicht für Home-PCs.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Netlogon [Anmeldedienst]
Friendly Name: Anmeldedienst
Interner Name: Netlogon
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert oder manuell (für Windows-Domäne)
Beschreibung:
So wichtig er klingt: Tatsächlich ist der „Anmeldedienst“ nur auf
Workstations in einer LAN-Umgebung notwendig, die sich auf einer
Windows-Domäne anmelden müssen. Das gilt längst nicht für alle
Firmen-PCs, ganz sicher nicht für Home-PCs.
Abhängig von:
Arbeitsstationsdienst
Benötigt für:
Keinen anderen Dienst
Netman [Netzwerkverbindungen]
Friendly Name: Netzwerkverbindungen
Interner Name: Netman
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst Netzwerkverbindungen verwaltet das Netzwerkcenter, in dem
alle LAN- und Remoteverbindungen angezeigt werden. Wenn Sie diesen
Dienst deaktivieren, wird das Icon für Netzwerkverbindungen in der
Taskleiste nicht mehr angezeigt. Die Konnektivität sollte dadurch aber
nicht beeinträchtigt werden.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
Netprofm [Netzwerklistendienst]
Friendly Name: Netzwerklistendienst
Interner Name: netprofm
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst identifiziert alle Netzwerke, mit denen Sie verbunden sind.
Zudem werden Einstellungen für diese Netzwerke abgespeichert und
Anwendungen werden davon in Kenntnis gesetzt, wenn sich diese ändern.
Ist der Dienst deaktiviert, können Sie nicht mehr über die Taskleiste
einsehen, ob Sie verbunden sind. Verbindungen sind dennoch nach wie vor
möglich.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst,
NLA (Network Location Awareness), Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst
NetTcpPortSharing [Net.Tcp-Portfreigabedienst]
Friendly Name: Net.Tcp-Portfreigabedienst
Interner Name: NetTcpPortSharing
Starttyp: deaktiviert
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht es TCP Ports über das net.tcp-Protokoll mit
anderen Rechnern eines Netzwerks zu teilen. Der Dienst ist standardmäßig
deaktiviert.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
NlaSvc [NLA (Network Location Awareness)]
Friendly Name: NLA (Network Location Awareness)
Interner Name: NlaSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Im LAN-Netz für Freigaben unentbehrlich (neben dem weiteren Dienst
Server): Dieser Dienst sammelt Informationen über die verbundenen
Netzwerke und stellt sie anhängigen Diensten zur Verfügung. Der Dienst
wird außerdem von der Windows Firewall genutzt. Wenn Sie diesen Dienst
deaktivieren, können andere Netzteilnehmer nicht mehr auf freigegebene
Ordner zugreifen, als Client funktioniert der PC weiterhin
uneingeschränkt. Beim Deaktivieren von „NlaSvc“ wird automatisch auch
der abhängige und eher entbehrliche Netzwerklistendienst abgeschaltet.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Netzwerklistendienst, SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst
Nsi [Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst]
Friendly Name: Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst
Interner Name: nsi
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Unentbehrlich: Der Dienst überwacht die vorhandenen
Netzwerkschnittstellen und gibt Änderungen an Systemprogramme und
Anwendungen weiter. Wenn Sie diesen Dienst deaktivieren, können Sie sich
nicht mehr mit anderen Rechnern verbinden.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
Arbeitsstationsdienst, Computerbrowser, DHCP-Client,
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung,
IP-Hilfsdienst, Netzwerkanmeldung, Netzwerklistendienst,
Netzwerkverbindungen, NLA (Network Location Awareness),
SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst,
Terminaldienstekonfiguration, WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst
P2pimsvc [Peernetzwerkidentitäts-Manager]
Friendly Name: Peernetzwerkidentitäts-Manager
Interner Name: p2pimsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst mit weitgehend unklarer Funktion existiert als optionale
Erweiterung seit Windows XP SP2. Wahrscheinliche Aufgabe ist die
Erkennung von P2P-Netzen unter dem noch kaum verbrieteten
IPv6-Protokoll. Das Deaktivieren des Dienstes hat derzeit keine
erkennbare Nebenwirkungen.
Abhängig von:
keinem andren Dienst
Benötigt für:
Peer Name Resolution-Protokoll, Peernetzwerk-Gruppenzuordnung,
PNRP-Computernamenveröffentlichungs-Dienst
P2psvc [Peernetzwerk Gruppenzuordnung]
Friendly Name: Peernetzwerk Gruppenzuordnung
Interner Name: p2psvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst mit weitgehend unklarer Funktion existiert als optionale
Erweiterung seit Windows XP SP2. Wahrscheinliche Aufgabe sind
Gruppenzuordnungsdienste für Peernetzwerke unter dem – noch – kaum
verbreiteten IPv6-Protokoll. Das Deaktivieren des Dienstes hat derzeit
keine erkennbare Nebenwirkungen.
Abhängig von:
Peernetzwerkidentitäts-Manager, Peer Name Resolution-Protokoll
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
PcaSvc [Programmkompatibilitäts-Assistent-Dienst]
Friendly Name: Programmkompatibilitäts-Assistent-Dienst
Interner Name: PcaSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ist Basis für den „Program Compatibility Assistant (PCA)“ –
eine mit Windows Vista eingeführte Funktion, die es ermöglicht, ältere
Programme mit Kompatibilitätsproblemen automatisch besser laufen zu
lassen. Wenn der PCA ein bekanntes Kompatibilitätsproblem erkennt,
nachdem der Benutzer ein älteres Programm gestartet hat, informiert er
denselben hierüber und bietet Lösungen an, die künftig beim Start des
Programms angewendet werden können.
Bei abgeschlossener Konfiguration und Software-Ausstattung eines PC
können Sie diesen Dienst deaktivieren; danach funktioniert dieser
Programmkompatibilitäts-Assistent nicht mehr. Sollte sich bei
Kompatibiltätsproblemen die Notwendigkeit dieser Funktion einstellen,
können Sie ihn bei Bedarf wieder aktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Pla [Leistungsprotokolle und -warnungen]
Friendly Name: Leistungsprotokolle und -warnungen
Interner Name: pla
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst zeichnet die Systemleistung des lokalen Computers in einem
Logfile auf, wenn diese Funktion in den “Einstellungen für die benannte
Protokollsammlung“ angeordnet wurde. Gegebenenfalls werden Warnmeldungen
ausgegeben. Der durchschnittliche User dürfte diesen Dienst kaum
nutzen. Standardmäßig eingestellt ist er aber ohnehin auf „manuellen“
Start bei Bedarf. Wenn Sie den Dienst deaktivieren, werden keine
Leistungsinformationen mehr erfasst.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
PlugPlay [Plug and Play]
Friendly Name: Plug & Play
Interner Name: PlugPlay
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der zentrale Dienst wird für viele andere Dienste benötigt. “Plug &
Play“ ermöglicht es dem Computer, Hardwareänderungen automatisch zu
erkennen und Folgeoperationen zu veranlassen. Das Deaktivieren dieser
Komponente würde die Systemstabilität empfindlich beeinflussen.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
Fax, Smartcard, Tablet PC-Eingabedienst, Telefonie, Verwaltung für
automatische RAS-Verbindung, Virtueller Datenträger, Windows-Audio,
Windows-Audio-Endpunkterstellung, Windows Driver Foundation –
Benutzermodus-Treiberframework, Windows Modules Installer
PNRPAutoReg [PNRP-Computernamenveröffentlichungs-Dienst]
Friendly Name: PNRP-Computernamenveröffentlichungs-Dienst
Interner Name: PNRPAutoReg
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst gehört wie einige weitere Peer-to-Peer-Dienste zum neuen
Microsoft-Datenübertragungsprotokoll für Peer-to-Peer Netze, welches
dynamische DNS Namensveröffentlichung ermöglicht und DNS Server
überflüssig machen soll. Der Dienst unterstützt zwar auch das geläufige
IPv4, soll aber erst unter IPv6 seine wesentliche Rolle erhalten.
Aktuell sind keine Nebenwirkungen zu befürchten, wenn der Dienst
deaktiviert bleibt.
Abhängig von:
Peer Name Resolution-Protokoll, Peernetzwerkidentitäts-Manager
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
PNRPsvc [Peer Name Resolution-Protokoll]
Friendly Name: Peer Name Resolution-Protokoll
Interner Name: PNRPsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht Peer-to-Peer – also ohne DNS-Server – die
Adressauflösung über das Internet. Wird dieser Dienst deaktiviert,
funktionieren einige Peer-to-Peer Anwendungen wie die
„Windows-Teamarbeit“ und Filesharing-Programme eventuell nicht mehr
uneingeschränkt.
Abhängig von:
Peernetzwerkidentitäts-Manager
Benötigt für:
Peernetzwerk-Gruppenzuordnung, PNRP-Computernamenveröffentlichungs-Dienst
ProfSvc [Benutzerprofildienst]
Friendly Name: Benutzerprofildienst
Interner Name: ProfSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Unentbehrlich! Dieser Dienst lädt und entlädt Benutzerprofile. Ohne
diesen Dienst wäre keine Anmeldung am System möglich. Entladen im
laufenden System macht Windows nahezu unbenutzbar. Finger weg!
Abhängig von:
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Anwendungsinformationen
ProtectedStorage [Geschützter Speicher]
Friendly Name: Geschützter Speicher
Interner Name: ProtectedStorage
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst stellt einen geschützten Speicherplatz für vertrauliche Daten
wie Passwörter und private Schlüssel zur Verfügung und verhindert den
Zugriff durch andere Benutzer, Prozesse oder nicht autorisierte Dienste.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
qwave [Verbessertes Windows-Audio-Video-Streaming]
Friendly Name: Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming
Interner Name: qwave
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst mit dem Kürzel „qWave“ ist eine Netzwerkplattform für Audio-
und Video-Streaming-Anwendungen auf privaten IP-Netzwerken. Seine
Aufgabe ist es, die Streamingleistung und Zuverlässigkeit zu verbessern,
indem die ordnungsgemäße Funktion aller zusammenwirkenden Komponenten
überwacht wird. Zudem ist der Dienst für Anwendungs Feedback und
Bandbreitenzuteilung bei Streaminganwendungen zuständig.
Wenn Sie einen Streaming-Client nutzen, belassen Sie die Einstellung auf
„manuell“, andernfalls können Sie den Dienst auch abschalten.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
RasAuto [Verwaltung für automatische RAS-Verbindung]
Friendly Name: Verwaltung für automatische RAS-Verbindung
Interner Name: RasAuto
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst erstellt auf Programmanfrage eine Verbindung zu einem
Remote-Netzwerk. In einigen wenigen Fällen kann dieser Dienst für den
Anmeldevorgang bei Dial-Up und DSL Internet Verbindungen erforderlich
sein. In den allermeisten Fällen ist der Service entbehrlich.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Telefonie, Plug & Play, RAS-Verbindungsverwaltung, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
RasMan [RAS-Verbindungsverwaltung]
Friendly Name: RAS-Verbindungsverwaltung
Interner Name: RasMan
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst ist notwendig für Modem-, VPN- und ISDN-Verbindungen, daneben
auch bei DSL mit direkten PPPoE-Verbindungen. Falls Sie eine dieser
Verbindungsmöglichkeiten nutzen, dürfen Sie den Dienst nicht
deaktivieren. Bei normalen DSL-Verbindungen per Router ist der Dienst
hingegen entbehrlich.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung, Routing und RAS, Verwaltung für automatische RAS-Verbindung
RemoteAccess [Routing und RAS]
Friendly Name: Routing und RAS
Interner Name: RemoteAccess
Starttyp: deaktiviert
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst erlaubt die Einwahl in ein Firmen-Netzwerk mit Hilfe eines
Modems oder via ISDN. Dabei muss „RemoteAccess“ auf dem Firmen-Rechner
laufen, auf dem man sich einwählen will. In den meisten Firmen ist eine
solche Direkteinwahl schon aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Sie können diesen Dienst deaktiviert lassen, wenn Sie keinen
Remotezugriff benötigen, desgleichen, falls Sie einen externe
Hardware-Firewall oder einen Router für Ihre Internetverbindung nutzen.
Seltene Ausnahmen sind VPN Tunneling oder ICS (Gemeinsame Nutzung der
Internetverbindung),
Abhängig von:
Basisfiltermodul, DCOM-Server-Prozessstart, RAS-Verbindungsverwaltung
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
RemoteRegistry [Remoteregistrierung]
Friendly Name: Remoteregistrierung
Interner Name: RemoteRegistry
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Mit der Remoteregistrierung erlauben Sie den Fernzugriff auf die in der
Registry enthaltenen Einstellungen. Dies ist im Firmennetz oft erwünscht
oder sogar notwendig. Am Home-PC empfiehlt es sich, den Dienst zu
deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
RpcLocator [RPC-Locator]
Friendly Name: RPC-Locator
Interner Name: RpcLocator
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ist zuständig für die Verwaltung der
RPC-Namendienstdatenbank. Im Unterschied zum lebenswichtigen
Remoteprozeduraufruf (RPC) scheint der RPC-Locator aber nur für
verteilte Anwendungen im Netz zuständig. Mir sind keine Nebenwirkungen
nach Deaktivieren dieses Dienstes bekannt.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
RpcSs [Remoteprozeduraufruf (RPC)]
Friendly Name: Remoteprozeduraufruf (RPC)
Interner Name: RpcSs
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Ein absolut unentbehrlicher Dienst! Das Deaktivieren macht das System praktisch unbenutzbar, da alle abhängigen Dienste streiken (so gut wie alle) und damit auch das neuerliche Aktivieren des RPC-Dienstes zur unüberwindlichen Hürde wird. Finger weg!
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart
Benötigt für:
die allermeisten anderen Dienste
SamSs [Sicherheitskonto-Manager]
Friendly Name: Sicherheitskonto-Manager
Interner Name: SamSs
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser unentbehrliche Dienst speichert Sicherheitsinformationen für
lokale Benutzerkonten. Nachdem dieser Dienst gestartet ist, teilt er
seine Bereitschaft an weitere Dienste mit, die ohne ihn möglicherweise
nicht korrekt gestartet werden können. Aufgrund seiner Bedeutung kann
der Sicherheitskonto-Manager über die Dienste-Konsole Services.msc nicht
deaktiviert werden.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Computerbrowser, Distributed Transaction Coordinator, KtmRm für Distributed Transaction Coordinator, Server
SCardSvr [Smartcard]
Friendly Name: Smartcard
Interner Name: SCardSvr
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht das Lesen von Smartcards. Dabei handelt es sich um
Chipkarten, die in der Regel zur Authentifizierung eines Benutzers
dienen. Diese Methode ist bislang allenfalls im professionellen Umfeld
verbreitet, im privaten Umfeld eher selten; wenn Sie keine Smartcards
nutzen, können Sie den Dienst ohne Bedenken deaktivieren.
Abhängig von:
Plug & Play
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Schedule [ Aufgabenplanung ]
Friendly Name: Aufgabenplanung
Interner Name: Schedule
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Unentbehrlich und nicht deaktivierbar: Der Dienst ermöglicht nicht nur
die „Aufgabenplanung“ durch den Anwender, sondern arbeitet als zentrale
Zeitsteuerung diverse System-eigener Windows-Dienste. Diese
automatisierten Vorgänge haben seit Windows Vista erhbeblich an Umfang
und Bedeutung gewonnen.
Abhängig von:
Remoteprozeduraufruf (RPC), Ereignisprotokoll, DCOM-Server-Prozessstart
Benötigt für:
Keinen anderen Dienst
SCPolicySvc [Richtlinie zum Entfernen der Smartcard]
Friendly Name: Richtlinie zum Entfernen der Scmartcard
Interner Name: SCPolicySvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Smartcards sind in der Regel Kreditkarten große Chipkarten, die oft
Informationen bezüglich Zugangsrechten speichern. Dieser Dienst legt
Aktionen fest, die ausgeführt werden, wenn die Smartcard durch den
Nutzer entfernt wird. Wenn Sie keinen Smartcard-Leser verwenden, können
Sie diesen Dienst getrost deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
SDRSVC [Windows-Sicherung]
Friendly Name: Windows-Sicherung
Interner Name: SDRSVC
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ist notwendig, wenn Sie auf die Backup- und
Systemwiederherstellungs-Komponenten von Windows 7 und Vista
zurückgreifen wollen („Sichern und Wiederherstellen“).
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Seclogon [Sekundäre Anmeldung]
Friendly Name: Sekundäre Anmeldung
Interner Name: seclogon
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht es, Prozesse in einem anderen User-Kontext zu
starten. Das Windows-eigene Programm für diese Aktion ist Runas.EXE.
Dieser Befehl erlaubt es, für eine bestimmte Aktion Administratorrechte
durchzusetzen, selbst wenn Sie gegenwärtig nicht als Administrator
angemeldet sind, darüber hinaus sogar Systemrechte, sofern das
Ausgangskonto Administratorrechte hat. Umgekehrt können im Admin-Kontext
Prozesse im eingeschränkten User-Kontext gestartet werden.
Anwender, die diese Möglichkeit nie nutzen, können den Dienst deaktivieren oder auf „manuell“ setzen.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Sens [Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse]
Friendly Name: Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse
Interner Name: SENS
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert (Desktop-PC), automatisch (Notebook)
Beschreibung:
Dieser Dienst verfolgt Systemereignisse wie Windows-Anmeldungen sowie
Netzwerk- und Stromversorgungsereignisse. Er informiert außerdem
Ereignissystembezieher von COM+ über diese Ereignisse.
In einer Desktop-Umgebung ist uns derzeit kein Szenario bekannt, in dem
die Systemereignisbenachrichtigung unbedingt benötigt wird. Für
Notebook-Besitzer ist dieser Dienst hingegen wichtig, da er unter
anderem dafür sorgt, dass bei niedrigem Batteriestand die konfigurierten
Aktionen ausgeführt werden.
Abhängig von:
COM+-Ereignissystem
Benötigt für:
COM+-Systemanwendung
SessionEnv [Terminaldienstekonfiguration]
Friendly Name: Terminaldienstekonfiguration
Interner Name: SessionEnv
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst ist für die Konfiguration und Aufrechterhaltung aller
Sitzungen bezüglich Terminaldienste und der Funktion „Remotedesktop“
zuständig.
Abhängig von:
Arbeitsstationsdienst, DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst,
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
SharedAccess [Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung]
Friendly Name: Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
Interner Name: SharedAccess
Starttyp: deaktiviert
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Mit Hilfe dieses Dienstes können Sie die Internetverbindung mit anderen
Computern teilen – etwa im Heimnetzwerk (Internetverbindungsfreigabe).
Ihr Computer dient somit sozusagen als Router und stellt den anderen
Netzwerkteilnehmer Funktionen für die Netzwerkadressübersetzung,
Adressierung, Namensauflösung und Firewall zur Verfügung.
Dieser Dienst ist im Firmennetz unnötig und spielt auch im Heimnetz bei
zunehmender Verbreitung von DSL-Routern keine wesentliche Rolle mehr.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Basisfiltermodul,
Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst, Netzwerkverbindungen,
RAS-Verbindungsverwaltung, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Windows-Verwaltungsinstrumentation,
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
ShellHWDetection [Shellhardwareerkennung]
Friendly Name: Shellhardwareerkennung
Interner Name: ShellHWDetection
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ist für die “Auto-Play“ Funktion notwendig. Beispielsweise
öffnet sich beim Einlegen einer CD ein Dialogfeld, in dem der User
wählen kann, mit welchem Programm der CD Inhalt geöffnet werden soll.
Anwender, die dieser Automatismus eher stört, sollten die
“Shellhardwareerkennung“ deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Windows-Bilderfassung
Slsvc [Softwarelizenzierung]
Friendly Name: Softwarelizenzierung
Interner Name: slsvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht den Download und die Installation digitaler
Signaturen und Lizenzen. Sein Abschalten würde nicht zuletzt das
Windows-Update beeinträchtigen bis verhindern, ebenso die Aktivierung
von System und Software.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
ReadyBoost, SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst
SLUINotify [SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst]
Friendly Name: SL-Benutzerschnittstellen-Benachrichtigungsdienst
Interner Name: SLUINotify
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst ist für den Lizenzierungsvorgang von Software notwendig,
so etwa auch für die Aktivierung von Windows. Er untersteht dem Dienst
„Softwarelizenzierung“ und sorgt für die fälligen Warnmeldungen an den
Benutzer bezüglich abgelaufener Lizenzierungsfristen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Netzwerklistendienst,
Netzwerspeicher-Schnittstellendienst, NLA (Network Location Awareness),
Remoteprozeduraufruf (RPC), Softwarelizenzierung
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
snmptrap [SNMP-Trap]
Friendly Name: SNMP-Trap
Interner Name: snmptrap
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Bei SNMP (Simple Network Management Protocol) handelt es sich um ein
eigenständiges Netzwerk Protokoll, das verschiedene Netzwerkelemente
(Server, Switches, Router, Drucker oder andere Computer) von einer
zentralen Station aus überwacht. Die Aufgabe des SNMP-Trap-Dienstes ist
es dabei, unaufgeforderte Nachrichten (TRAP-Nachrichten) von den
verbundenen Geräten zu empfangen und diese an SNMP-Management-Programme
weiterzuleiten. Dieser Dienst ist praktisch nur für
Netzwerk-Administratoren relevant und kann in den allermeisten Fällen
deaktiviert werden.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Spooler [Druckwarteschlange]
Friendly Name: Druckwarteschlange
Interner Name: Spooler
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst ist für die Abwicklung aller anstehenden Druckaufträge
zuständig. Daten, welche an den Drucker gesendet werden sollen werden
dabei vorübergehend in einem temporären Ordner hinterlegt. Wenn Sie
diesen Dienst deaktivieren, zeigt Windows angeschlossene Drucker
generell nicht mehr an. Drucken ist dann nicht mehr möglich. Anwender,
die mit dem papierlosen Büro ernst machen, können den Dienst natürlich
deaktivieren.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
ssdpsrv [SSDP-Suche]
Friendly Name: SSDP-Suche
Interner Name: ssdpsrv
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst spürt im IP-basierten Netzwerk Geräte auf, die dann über
Vistas neues “UPnP“ automatisch initialisiert werden sollen. SSDP steht
für Simple Service Discovery Protocol, UPnP für Universal Plug &
Play zum Ansteuern von IP-Geräten (Stereoanlagen, Router, Drucker,
Haussteuerungen).“UPnP“ ist damit quasi das Plug & Play für das
Netz. Mit dem Abschalten von “UPnP“ und “SSDP“ entfällt die Möglichkeit,
Media Player-Bibliotheken für andere Abspiel- und Mediengeräte im
Netzwerk freizugeben. Sie können also beispielsweise nicht mit einer
XBox 360 Medien eines Windows-Rechners abspielen. Von solchen
Sonderfällen abgesehen ist dieser Dienst in den allermeisten Fällen
entbehrlich.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
stisvc [Windows-Bilderfassung]
Friendly Name: Windows-Bilderfassung
Interner Name: stisvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst leistet die Windows-eigene Bilderfassung für Scanner und
Kameras. Falls Sie die Bilder Ihrer Kamera mit der Browser-Software
Ihres Kameraherstellers herunterladen, benötigen Sie diesen Dienst
nicht.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Shellhardwareerkennung
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
swprv [Microsoft-Softwareschattenkopie-Anbieter]
Friendly Name: Microsoft-Softwareschattenkopie-Anbieter
Interner Name: swprv
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst verwaltet softwarebasierte Schattenkopien, die wiederum
durch den Dienst Volumenschattenkopie erstellt wurden. Eine
Schattenkopie stellt ein konsistentes, schreibgeschütztes Abbild eines
Datenträgers zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und wird im Ordner
\System Volume Information abgelegt. Mit Hilfe von Sicherungssoftware
können solche Snapshots dann auf Sicherungs-Datenträger kopiert werden.
Einzelne Dateien oder Ordner können ferner über „Vorgängerversionen“ im
laufenden Betrieb zurückgeschrieben werden.
Ist der Dienst deaktiviert, arbeiten diese Funktionen nicht mehr, und
auch die Ausführung des Systemwiederherstellung ist nicht mehr möglich.
Trotz dieser Nachteile halten ich diesen Dienst und die zugehörigen
Funktionen für normale Home- oder Arbeitsrechner entbehrlich, ferner
auch den Dienst “Volumenschattenkopie”.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
SysMain [Superfetch]
Friendly Name: Superfetch
Interner Name: SysMain
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst protokolliert die User-Gewohnheiten, sorgt daraufhin für
den Preload häufig genutzer Software in den Speicher und optimiert
ferner im Hintergrund die Festplatte so, dass die bevorzugten
Anwendungen an die schnellsten Bereiche der Platte verschoben werden.
Die Bewertung dieser Funktion ist umstritten: Sie verkürzt einerseits
die Startzeiten des Systems ebenso wie die der berücksichtigten
Anwendungen, andererseits steigt die RAM-Auslastung und der Stress für
die Festplatte.
Ob Sie den Dienst abschalten sollten, hängt von vielen individuellen
Faktoren hängt (RAM-Größe, Festplattenleistung, Festplattengeräusch,
Größe der meistgenutzten Anwendungen, Konstanz der meistgenutzten
Anwendungen, Wichtigkeit der Boot-Performance…).
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
TabletInputService [Tablet PC-Eingabedienst]
Friendly Name: Tablet PC-Eingabedienst
Interner Name: TabletInputService
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst wird ausschließlich für die Eingabe per Zeichenstift bei
Tablet-PCs benötigt. Aus welchem Grund Microsoft diesen Dienst dennoch
auf jedem REchner automatisch starten lässt, bleibt unerfindlich. Ist
Windows nicht auf einem Touchscreen oder Tablet-PC installiert, sollten
Sie ihn deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Plug & Play, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
TapiSvr [Telefonie]
Friendly Name: Telefonie
Interner Name: TapiSvr
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst bietet TAPI-Unterstützung (Telephony Application Programming
Interface) für Telefonie-Anwendungen wie etwa Software-Telefonie oder
Videokonferenzprogramme zwischen dem eigenen Computer und LAN-Servern,
die diesen Dienst auch verwenden. Benötigt wird dieser Dienst auch für
Modem-Verbindungen und den Fax Dienst.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Plug_&_Play, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Fax, RAS-Verbindungsverwaltung
TBS [TPM-Basisdienste]
Friendly Name: TPM-Basisdienste
Interner Name: TBS
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst ermöglicht den Zugriff auf das “Trusted Platform Modul
(TPM)“, welches Hardware-basierte Verschlüsselungsdienste für
Systemkomponenten und Anwendungen bietet. Der Dienst ist überall dort
notwendig, wo TPM-Chips im Mainboard verbaut sind. Dies ist inzwischen
bei alleren neueren Rechnern der Fall. Der Starttyp „manuell“ ist
ausreichend.
Abhängig von:
Keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
TermService [Terminaldienste]
Friendly Name: Terminaldienste
Interner Name: TermService
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst erlaubt mehreren Usern, sich mit diesem Computer (auf dem der
TermService läuft) zu verbinden, virtuelle Windows-Desktop Sitzungen
abzuhalten und dessen Windows- Programme zu nutzen. Wenn
„Terminaldienste“ deaktiviert wird, stehen die „schnelle
Benutzerumschaltung“, “Remoteunterstützung“ und “Remotedesktop“ nicht
mehr zur Verfügung. Für ausgehende Verbindungen zu einem anderen
“Remotedesktop“ wird dieser Dienst nicht benötigt.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Anschlussumleitung für Terminaldienst im Benutzermodus,
Windows Media Center Extender-Dienst
Themes [Designs]
Friendly Name: Designs
Interner Name: Themes
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch oder deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ist notwendig für spezielle GUI-Themes (Aero unter Windows 8 /
7 / Vista). Bei „klassischer“ Darstellung kann dieser Dienst
abgeschaltet werden. Dies geschieht nicht automatisch, wenn sich der
Anwender für die klassische Oberfläche entscheidet.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Threadorder [Server für Threadsortierung]
Friendly Name: Server für Threadsortierung
Interner Name: threadorder
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst sorgt für die optimierte zeitliche Reihenfolge bei der Abarbeitung gruppierter Programm-Threads.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
TrkWks [Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)]
Friendly Name: Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)
Interner Name: TrkWks
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Kontrolliert und korrigiert die Verknüpfungen von NTFS Dateien zwischen
vernetzten Rechnern: Ist etwa eine Datei auf “Rechner A“ durch einen
Shortcut auf “Rechner B“ verlinkt, und man verschiebt die Zieldatei auf
“Rechner A“, so veranlasst dieser Dienst “Rechner B“, den geänderten
Link automatisch zu aktualisieren.
Ich halte diesen Service für mehr als marginal und empfehle, ihn zu deaktiveren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
TrustedInstaller [Windows Modules Installer]
Friendly Name: Windows Modules Installer
Interner Name: TrustedInstaller
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst steuert und ermöglicht die Installation, Modifizierung und
Deinstallation von Windows Updates sowie von optionalen Komponenten.
Lediglich zum Herunterladen der kritischen Sicherheits-Updates durch den
“Windows Update Service“ ist der Service nicht erforderlich.
Abhängig von:
Plug & Play
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
UI0Detect [Erkennung interaktiver Dienste]
Friendly Name: Erkennung interaktiver Dienste
Interner Name: UI0Detect
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst benachrichtigt den Anwender, wenn die Möglichkeit besteht, in
den Ablauf eines interaktiven Dienstes einzugreifen. Dieser Service
wurde notwendig, weil Windows seit Vista aus Sicherheitsgründen alle
Dienste in die Systemsession 0 verbannt, die keine Verbindung zur
Oberfläche besitzt. Dienste bleiben daher unsichtbar und stumm, selbst
wenn sie im Prinzip interaktiv programmiert sind.
Wird dieser Dienst gestoppt, wird der Benutzer nicht mehr informiert,
wenn er die Möglichkeit hat, mit einem interaktiven Dienst via
Windows-Dialog zu kommunizieren. In der Realität spielt die Interaktion
mit Windows-Diensten allerdings eine so marginale Rolle, dass Sie den
Hilfsdienst auch deaktivieren können.
Tipp: Unter Vista und Windows 7 (nicht Windows 8) lässt sich der
Dienst nutzen, um erst per Kommandozeile, von dort auch per Explorer, im
Systemkontext zu arbeiten. Eine Batchdatei (RunAsSystem), die dies
demonstriert und vereinfacht, finden Sie hier.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
UmRdpService [Anschlussumleitung für Terminaldienst im Benutzermodus]
Friendly Name: Anschlussumleitung für Terminaldienst im Benutzermodus
Interner Name: UmRdpService
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell oder deaktiviert
Beschreibung:
Ermöglicht das Umleitung von Druckern, Laufwerken und Ports beim
Benutzen der „Remotedesktop“-Komponente. der Dienst ist unnötig, solange
diese Windows-Komponente nicht genutzt wird.
Abhängig von:
Arbeitsstationsdienst
Benötigt für:
Keinen anderen Dienst
upnphost [UPnP-Gerätehost]
Friendly Name: UPnP-Gerätehost
Interner Name: upnphost
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst Universal Plug & Play-Support und sorgt für die
automatische Erkennung UPnP-fähigen Geräten im Netzwerk. Trotz der
Einführung von UPnP bereits unter Windows XP konnte die Technologie bis
heute nicht wirklich Fuss fassen. Aufgrund der geringen Verbreitung kann
der Dienst auch deaktiviert werden.
Abhängig von:
SSDP-Suche
Benötigt für:
Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst
UxSms [Sitzungs-Manager für Desktopfenster-Manager]
Friendly Name: Sitzungs-Manager für Desktopfenster-Manager
Interner Name: UxSms
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert / automatisch
Beschreibung:
Einer der ressourcen-intensivsten Dienste: Er ist für die verschiedenen
“Aero“ Effekte zuständig und sorgt dafür, dass auch Anwendungen laufen,
welche an sich nicht mit “Aero“ kompatibel sind. Wenn Sie diesen Dienst
deaktivieren, sparen Sie Prozessorleistung und erheblich RAM, müssen
aber im Gegenzug auf die neuen “Aero“ Effekte verzichten.
Unter Windows 8 lässt sich der Dienst nicht mehr deaktivieren.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt:
keinen anderen Dienst
VDS [Virtueller Datenträger]
Friendly Name: Virtueller Datenträger
Interner Name: vds
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst „Virtual Disk Service“ vereinfacht die Verwaltung für diverse
Datenträger, Dateisysteme, RAID-Controller und Festplatten im Netzwerk.
Es handelt sich, vereinfacht gesprochen, um eine Storage-Technik, die
verschiedene Speichergeräte virtualisiert und übersichtlich
zusammenfasst. Eine Veranlassung, diesen Dienst zu starten, besteht nur
in einem Netzwerk mit Windows Server 2003 bis 2008.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Plug & Play, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
VSS [Volumenschattenkopie]
Friendly Name: Volumenschattenkopie
Interner Name: VSS
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst ist notwendig für die Verwaltung und Durchführung von
Schattenkopien. Bei dieser Technik werden Dateiveränderungen
schreibgeschützt aufgezeichnet, und das System kann bei Bedarf wieder
zurückgesetzt oder einzelne Dateien („Vorgängerversion“) zurückkopiert
werden. Schattenkopien erhöhen die Sicherheit, sind aber relativ
ressourcen-intensiv. Ob Sie den Dienst deaktivieren wollen, ist
Ermessenssache.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC),
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
W32Time [Windows-Zeitgeber]
Friendly Name: Windows-Zeitgeber
Interner Name: W32Time
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch / deaktiviert
Beschreibung:
Diesem Dienst für den automatischen Uhrenabgleich mit Internet-Servern
wird in vielen Foren zu Unrecht Spionage-Funktionen nachgesagt: Der
Windows-Zeitgeber verbindet sich mit einem entsprechenden Dienst auf
einem Rechner, der mit einer Atomuhr – beispielsweise über eine Funkuhr –
synchronisiert ist, und errechnet über verschiedene Algorithmen die
Abweichung der lokalen Rechneruhr von der richtigen Zeit. Wirklich
notwendig ist der Dienst aber allenfalls in LAN-Umgebungen mit
zeitkritischer Aufgabenplanung.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Wbengine [Block Level Backup Engine Service]
Friendly Name: Block Level Backup Engine Service
Interner Name: wbengine
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell oder deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst fehlt den Home-Versionen. Er ist notwendig für die
Backup-Funktionen unter Windows 7/Vista Enterprise und Ultimate
(Complete PC-Sicherung). Der Dienst ist für die Datensicherung und
-wiederherstellung auf Blockebene zuständig und ermöglicht die
Verwendung von optischen Medien (via UDFS), oder Festplatten-Partitionen
als Backupmedium. Anwender, die das Complete PC-Backup nicht einsetzen,
können den Dienst deaktivieren.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
wcncsvc [Windows-Sofortverbindung – Konfigurationsregistrierungsstelle]
Friendly Name: Windows-Sofortverbindung – Konfigurationsregistrierungsstelle
Interner Name: wcncsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst fungiert als Registrator und gibt Zugangsberechtigungen
bei Netzwerkanmeldungen über die Windows “Connect Now“ Technologie aus.
Letztere vereinfacht das Einrichten von WLAN-Netzen. Wenn Sie kein WLAN
verwenden, können Sie den Dienst deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WcsPlugInService [Windows-Farbsystem]
Friendly Name: Windows-Farbsystem
Interner Name: WcsPlugInService
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht es, Farbsysteme von Drittanbietern als Plug-In
in das Vista eigene Farbmodell einzubinden. Wird der Dienst deaktiviert,
kann es theoretisch bei der Ausführung von Programmen zu
Darstellungsfehlern kommen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WdiServiceHost [Diagnoseservicehost]
Friendly Name: Diagnoseservicehost
Interner Name: WdiServiceHost
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen):
Beschreibung:
Der Diagnoseservicehost dient dem Auffinden etwaiger Probleme von Windows
Komponenten. Dabei versucht das Programm, Hinweise zur Behebung dieser
Probleme bereitzustellen. Wenn dieser Dienst deaktiviert ist, können Sie
die Windows Systemdiagnose nicht mehr
verwenden.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WdiSystemHost [Diagnosesystemhost]
Friendly Name: Diagnosesystemhost (eigtl. „Diagnostesystemhost“)
Interner Name: WdiSystemHost
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Hierbei handelt es sich um einen weiteren Dienst, welcher von der
Windows internen System-Diagnose verwendet wird, um Speicher-,
Festplatten- und Dateiprobleme aufzuspüren. Wenn Sie den
Diagnoserichtliniendienst deaktiviert haben, dann können Sie auch diesen
Dienst deaktivieren.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WebClient [WebClient]
Friendly Name: WebClient
Interner Name: WebClient
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der “WebClient“ ist nicht so relevant wie sein Name vermuten ließe: Er
ermöglicht es Programmen, Internet-basierte Dateien zu erstellen, darauf
zuzugreifen und sie zu verändern. Wenn dieser Dienst beendet wird,
werden diese Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Solange Sie
keine WebDAV-Funktionen verwenden, etwa mit Frontpage, können Sie diesen
Dienst ausschalten. Der normale Web-oder FTP-Zugriff funktioniert
weiterhin.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Wecsvc [Windows-Ereignissammlung]
Friendly Name: Windows-Ereignissammlung
Interner Name: Wecsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst protokolliert alle möglichen Systemereignisse (Eventlogging).
Dieser Service ist insbesondere für Netzwerkadmins nützlich, kann aber
auch normalen Anwendern helfen, Systemprobleme oder Sicherheitsprobleme
zu analysieren. Im normalen Benutzeralltag ist der Dienst entbehrlich.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
wercplsupport [Unterstützung in der Systemsteuerung unter Lösungen für Probleme]
Friendly Name: Unterstützung in der Systemsteuerung unter Lösungen für Probleme
Interner Name: wercplsupport
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst ermöglicht es, Fehlermeldungen an Microsoft zu senden und
das Applet „Lösungen für Probleme“ in der Systemsteuerung zu benutzen.
Wenn Sie allerdings letztere Funktion in Anspruch nehmen, werden relativ
große Datenmengen an Microsoft gesendet. Wer sich davon keine Vorteile
verspricht, sollte den Dienst deaktivieren.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WerSvc [Windows-Fehlerberichterstattungsdienst]
Friendly Name: Windows-Fehlerberichterstattungsdienst
Interner Name: WerSvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst informiert Microsoft über die Ursache von
Programmabstürzen, sofern der Anwender dazu bereit ist, das
Fehlerprotokoll an Microsoft zu senden. Dieses enthält unter anderem
einen Abzug des Hauptspeichersegments, in dem der Fehler aufgetreten
ist. Für Microsoft und die künftige Fehlerbehebung mag das hilfreich
sein, der normale Anwender wird nach dem Absturz aber nicht noch mehr
Zeit verlieren wollen: Bei deaktivertem Dienst entfällt die
Berichterstattung.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WinDefend [Windows-Defender]
Friendly Name: Windows-Defender
Interner Name: WinDefend
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Basisdienst für Spyware und Virusschutz von Microsoft: Er scannt den
Computer auf unerwünschte Software, lässt Sie die Scanns planen und
hält die Malware Definitionen auf dem neuesten Stand.
Wenn Sie für diese Sicherheitsaspekte andere Software verwenden, dann
deaktivieren Sie den “Defender“ über die Systemsteuerung. Wenn Sie nur
den Dienst über Services.msc deaktivieren, gibt Vista bei jedem Start
eine nervende Warnmeldung aus.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WinHttpAutoProxySvc [WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst]
Friendly Name: WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst
Interner Name: WinHttpAutoProxySvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst implementiert das WPAD-Protokoll (Web Proxy
Auto-Discovery) für Windows HTTP-Dienste (WinHTTP). WPAD ermöglicht
HTTP-Clients die automatische Erkennung einer Proxykonfiguration.
Wenn Sie den “WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst“ anhalten oder
deaktivieren, wird anstelle des externen Dienstprozesses das
WPAD-Protokoll innerhalb des HTTP-Clientprozess ausgeführt. Dies führt
im Normalfall zu keinerlei Funktionsverlust. In jedem Fall abschalten
können Sie den Dienst, wenn Sie keinen Proxy-Server verwenden.
Abhängig von:
DHCP-Client, Netzwerkspeicher-Schnittstellendiesnt
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Winmgmt [Windows-Verwaltungsinstrumentation]
Friendly Name: Windows-Verwaltungsinstrumentation
Interner Name: Winmgmt
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Unentbehrlich: Der Dienst “Windows-Verwaltungsinstrumentation“ (WMI)
stellt eine gemeinsame Schnittstelle und ein Objektmodell für den
Zugriff auf Verwaltungsinformationen zu Betriebssystemen, Geräten,
Anwendungen und Diensten bereit. WMI ist eine zur aktuellen Generation
von Microsoft-Betriebssystemen gehörende Infrastruktur für die
Erstellung von Verwaltungsanwendungen und für die Instrumentation.
Der Dienst wird seit Windows Vista standardmäßig installiert und
automatisch ausgeführt. Wenn der Dienst angehalten wird, kann ein
Großteil der Windows-basierten Software nicht ordnungsgemäß ausgeführt
werden.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Geminsame Nutzung der Internetverbindung, IP-Hilfsdienst, Sicherheitscenter
WinRM [Windows-Remoteverwaltung (WS-Verwaltung)]
Friendly Name: Windows-Remoteverwaltung (WS-Verwaltung)
Interner Name: WinRM
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst stellt das “WS-Management“-Protokoll für die
Remoteverwaltung der Hard- und Software eines Netzwerks bereit. Dabei
spürt “WinRM“ Anfragen vernetzter Geräte auf und bearbeitet diese. Der
Dienst muss dabei entweder die Eingabeaufforderung mit winrm.cmd oder
durch Gruppenrichtlinien konfiguriert werden. Wenn Sie
Systemadministrator sind und Funktionen wie “WMI“ und das Sammeln von
Systemereignissen auf Netzwerkrechner benötigen, können Sie diesen
Dienst nicht deaktivieren.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Wlansvc [Automatische WLAN-Konfiguration]
Friendly Name: Automatische WLAN-Konfiguration
Interner Name: Wlansvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Dieser Dienst unterstützt die automatische Konfiguration von
WLAN-Netzwerken und ist dort unentbehrlich (die Voreinstellung „manuell“
genügt allerdings). Auf PCs ohne WLAN-Adapter können Sie diesen Dienst
deaktivieren.
Abhängig von:
EapHost, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
Keinen anderen Dienst
WmiApSrv [WMI-Leistungsadapter]
Friendly Name: WMI-Leistungsadapter
Interner Name: WmiApSrv
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Der Dienst stellt den Netzwerk-Clients die
Leistungsbibliotheksinformationen der
“Windows-Verwaltungsintrumentation“ (WMI) bereit. Die Informationen der
WMI sind praktisch nur für Netzwerkadministratoren relevant. Lokale
Scripts und die Wmi-Konsole (Wmic) funktionieren übrigens auch ohne
diesen Dienst.
Abhängig von:
keinem anderen Dienst
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WMPNetworkSvc [Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst]
Friendly Name: Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst
Interner Name: WMPNetworkSvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst gibt seit Windows Vista digitale Medien eines Rechners via
UPnP (Universal Plug and Play) automatisch anderen Windows-PCs
innerhalb des LAN-Netzwerkes frei. Insbesondere innerhalb von
Firmennetzen ist dieser Service nur irritierend oder gar entlarvend. Im
privaten Netz vereinfacht diese Funktion die Medienfreigabe, setzt aber
ein homogenes Windows-Netz voraus (Windows Vista / 7 / 8).
Abhängig von:
SSDP-Suche, UPnP-Gerätehost
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WPCSvc [Jugendschutz]
Friendly Name: Jugendschutz
Interner Name: WPCSvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser neue Vista-Dienst ermöglicht es, verschiedene Restriktionen für
andere PC-Benutzer einzustellen. Diese Jugendschutz-Einstellungen
betreffen Web-Regeln, Software-Verbote und Zeitregelungen. Wenn Sie
keine Kinder haben, die Ihren Rechner mitnutzen, können Sie auf diesen
Dienst verzichten.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
WPDBusEnum [Enumeratordienst für tragbare Geräte]
Friendly Name: Enumeratordienst für tragbare Geräte
Interner Name: WPDBusEnum
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst unterstützt den Datenaustausch zwischen dem Windows Media
Player und transportablen Speichermedien wie Digitalkameras oder
USB-Festplatten und erlaubt die Vergabe von Richtlinien für
angeschlossene Geräte. Die Basisfunktionalität angeschlossener
Massenspeicher bleibt jedoch auch erhalten, wenn dieser Dienst
deaktiviert wird.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
wscsvc [Sicherheitscenter]
Friendly Name: Sicherheitscenter
Interner Name: wscsvc
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Das „Sicherheitscenter“ überwacht Vistas Sicherheitseinstellungen und
ist nicht ohne weiteres deaktivierbar. Die Firewall sowie der
Windows-Defender benötigen diesen Dienst. Deaktivieren würde die
Sicherheit des PCs beeinträchtigen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC), Windows-Verwaltungsinstrumentation
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
Wsearch [Windows-Suche]
Friendly Name: Windows-Suche
Interner Name: Wsearch
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch / deaktiviert
Beschreibung:
Dieser Dienst fordert – vor allem unter dem älteren Windows Vista – zwar
erhebliche Systemleistung, ist aber für die tägliche Nutzung des
Rechners nahezu unentbehrlich. Abschalten können Sie den Dienst nur
dann, wenn Sie eine alternative Desktop-Suche installieren (Copernic,
Google).
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
wuauserv [Windows Update]
Friendly Name: Windows Update
Interner Name: wuauserv
Starttyp: automatisch
Starttyp (empfohlen): automatisch
Beschreibung:
Dieser Dienst ist zuständig für das Erkennen, Herunterladen und
Installieren von Updates für Vista und andere Programme. Wenn der Dienst
deaktiviert ist, können „Windows Update“ beziehungsweise die Funktion
„Automatische Updates“ nicht verwendet werden. Zudem können Programme
dann die “Windows Update Agent-Programmierschnittstelle“ (WUA API) nicht
mehr ansprechen.
Abhängig von:
DCOM-Server-Prozessstart, Remoteprozeduraufruf (RPC)
Benötigt für:
keinen anderen Dienst
wudfsvc [Windows Driver Foundation – Benutzermodus-Treiberframework]
Friendly Name: Windows Driver Foundation-Benutzermodus-Treiberframework
Interner Name: wudfsvc
Starttyp: manuell
Starttyp (empfohlen): manuell
Beschreibung:
Der Dienst verwaltet den Treiberhostprozess im eingeschränkten
Benutzermodus. Beim Benutzermodus-Treiberframework handelt es sich um
eine neue Entwicklungsplattform für Gerätetreiber, die mit Windows Vista
eingeführt wurde. Eine Einschränkung nach Deaktivieren des Dienstes ist
mindestens im Admin-Kontext nicht ersichtlich.
Abhängig von:
Plug & Play
Benötigt für:
keinen anderen Dienst